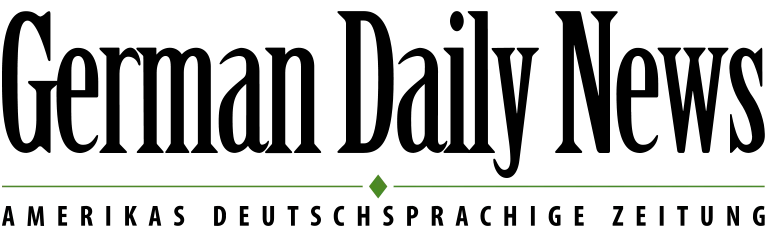Politik
Totale Einschränkung der Handlungsfähigkeit von Kommunen und Gemeinden
Wird es TTIP-freie Zonen geben?

Bildmontage (Quelle: Roland Kreisel)
GDN -
Die geplanten Freihandelsabkommen, wie zum Beispiel TTIP, CETA und das geplante Dienstleistungsabkommen TISA, beschränken ganze Länder, deren Städte, Landkreise und Gemeinden in ihren Handlungsspielräumen und bedrohen zudem auch noch kommunale Unternehmen.
Auch wenn die einzelnen Länder, deren Bundesländer, Städte, Landkreise, Gemeinden und kommunale Unternehmen die Auswirkungen zu spüren bekommen, sind die Länder, Kommunen und Gemeinden von den Verhandlungen ausgeschlossen und haben auch keine Möglichkeit ihr Veto einzubringen. Dies haben jetzt auch viele Kommunen in Deutschland und Frankreich erkannt, die sich nun kritisch zu den Handelsabkommen äußern und vor den Freihandelsabkommen warnen.
Speziell Frankreich stellt sich quer, denn das halbe Land hat sich symbolisch zu einer “TTIP-freien Zone“ erklärt. Doch auch in Deutschland folgt man dieser symbolischen Protestaktionen, denn auch hier erklären sich immer mehr Kommunen zu “TTIP-freien Zonen“.
Speziell Frankreich stellt sich quer, denn das halbe Land hat sich symbolisch zu einer “TTIP-freien Zone“ erklärt. Doch auch in Deutschland folgt man dieser symbolischen Protestaktionen, denn auch hier erklären sich immer mehr Kommunen zu “TTIP-freien Zonen“.
Das Umweltinstitut München e.V. hat die wichtigsten Punkte der kommunalen Einschränkungen zusammengefasst.
TTIP, CETA und TISA schränken den Handlungsspielraum von Kommunen empfindlich ein, weil
die Abkommen Regelungen zur öffentlichen Beschaffung auf die Ebene eines internationalen Abkommens heben. Eine Reform der Europäischen Vergabeverordnung im Sinne kleiner Kommunen, der Umwelt, regionalen Wirtschaftsförderung oder Sozialstandards wird so erschwert.
die EU-Kommission eine umfassende Liberalisierung von Dienstleistungen anstrebt, die auch kommunale Aufgaben wie Abfallverwertung, Abwasserentsorgung, Erwachsenenbildung und die kommunale Gesundheitsversorgung dem privatem Wettbewerb oder gar der Privatisierung aussetzt.
TTIP, CETA und TISA schränken den Handlungsspielraum von Kommunen empfindlich ein, weil
die Abkommen Regelungen zur öffentlichen Beschaffung auf die Ebene eines internationalen Abkommens heben. Eine Reform der Europäischen Vergabeverordnung im Sinne kleiner Kommunen, der Umwelt, regionalen Wirtschaftsförderung oder Sozialstandards wird so erschwert.
die EU-Kommission eine umfassende Liberalisierung von Dienstleistungen anstrebt, die auch kommunale Aufgaben wie Abfallverwertung, Abwasserentsorgung, Erwachsenenbildung und die kommunale Gesundheitsversorgung dem privatem Wettbewerb oder gar der Privatisierung aussetzt.
die kommunale Daseinsvorsorge - inklusive der Wasserversorgung - nicht von den Investitionsschutzklauseln ausgenommen wird, was multinationalen Konzernen erlaubt, Klagen darüber vor Schiedsgerichten anzustreben.
kommunale Entscheidungen und Genehmigungsverfahren ebenso unter die Investitionsschutzklauseln fallen und zu Klagen vor Schiedsgerichten führen können.
viele Kommunen sich intensiv um ihre Landwirtschaft kümmern, gentechnikfrei bleiben wollen, sich gegen Fracking wehren und in vielen anderen Bereichen aktiv sind. Die Abkommen könnten diese Bemühungen zunichte machen.
kommunale Entscheidungen und Genehmigungsverfahren ebenso unter die Investitionsschutzklauseln fallen und zu Klagen vor Schiedsgerichten führen können.
viele Kommunen sich intensiv um ihre Landwirtschaft kümmern, gentechnikfrei bleiben wollen, sich gegen Fracking wehren und in vielen anderen Bereichen aktiv sind. Die Abkommen könnten diese Bemühungen zunichte machen.
Doch die Kommunen sitzen nicht mit am Verhandlungstisch und sind auch nicht im Ratifizierungsprozess beteiligt. Ihre Verbände, wie der Deutsche Städte- und Gemeindebund, der Deutsche Landkreistag oder der Verband Kommunaler Unternehmen sowie die europäische Vereinigung EuroCities drängen auf eine Achtung kommunaler Interessen. Ob sich das jedoch in den Abkommen wiederfindet, ist zweifelhaft. Bei CETA ist sogar sicher, dass das nicht der Fall ist, denn das Abkommen ist bereits fertig verhandelt.
Für den Artikel ist der Verfasser verantwortlich, dem auch das Urheberrecht obliegt. Redaktionelle Inhalte von GDN können auf anderen Webseiten zitiert werden, wenn das Zitat maximal 5% des Gesamt-Textes ausmacht, als solches gekennzeichnet ist und die Quelle benannt (verlinkt) wird.